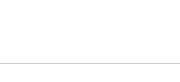von Roman Kurzmeyer
von Roman Kurzmeyer
Helmut Federle erlebt seine Existenz als eingebunden in das Leben der Formen. Es ist diese Erfahrung, die er in Malerei übersetzt. Seinen künstlerischen Formen begegnet man aber nicht nur im malerischen Werk, sondern auch auf Geweben, Keramiken, Möbeln und Kunstwerken aus seiner Sammlung im Wohnbereich des Ateliers und selbst in Gestalt einer auf der Straße gefundenen Zimmerpflanze, der er in seinem Wiener Atelier am großen Fenster neben der Bibliothek einen neuen Lebensort gab. Das, was um ihn da ist, blickt ihn an: Es sind alles Dinge, deren Individualität, Schönheit und Bedeutung einst Anlass für den Künstler waren, sie zu sammeln und mit ihnen in seinem Atelier zusammenzuleben. Dieses Atelier ist Ausdruck der Kultur seines Bewohners. Den schlanken Stängel jener Pflanze vor Augen, welche dem Licht entgegenwächst, zog Federle dunkle, suchende Linien über eine mattgolden-violette Malerei. Dem kleinen Gemälde gab er den provokanten Titel Gott (2000–2003). Der dänische Schriftsteller Erik Steffensen versteht das Bild als „Symbol für das Übersehene, das arme und fremde Gewächs, das wieder aufersteht sozusagen und sich über die Bildfläche verzweigt, als sei es ein zersplitterter Spiegel. Somit ist ‚Gott‘ kein persönliches Vorhaben des Künstlers, sondern eine zweifelnde Annäherung. Das etwas unsichere, asymmetrische, vibrierende, demütige Gewächs wächst über die goldene Wüste des Bildes hin. Vielleicht geschieht da etwas. Vielleicht entspringt genau hier eine Quelle?“1 Die Suche nach dem Absoluten im Individuellen und jene nach dem Individuellen im Absoluten bezeichnen zwei Bewegungen, aus denen die Malerei Federles hervorgeht.
1) Erik Steffensen, „God and Symmetry“, in: Helmut Federle. A Nordic View, Ausst.-Kat., Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien 2005, S. 17.
I.
Im Atelier gibt es neben den schlichten Arbeitstischen entlang der Fenster, einem Kasten in einer Raumecke, den Grafikschränken und einigen weiteren Möbeln, den Reisekoffern und zugedeckten Bilderkisten auch eine Nähmaschine. Auf dieser Maschine werden nicht nur schadhafte Kleidungsstücke ausgebessert, sondern auch Stoffe zu Hüllen für die Keramiken in Federles Sammlung verarbeitet. Ein Loch zu stopfen und die Fotografie der geflickten Stelle, welche den Buchstaben F als Naht zeigt, als künstlerische Arbeit aufzufassen, wie 1982 geschehen, visualisiert treffend, was es bedeuten könnte, die eigene Existenz aktiv in das Leben der Formen einzubinden. Federles Schaffen ist ein Versuch, den Gegensatz zwischen geometrisch und anthropomorph aufzuheben, und sein Werk ist deshalb auch als eine Anthropologie der Form zu diskutieren. Die Existenz einzubinden in das Leben der Formen, bedeutet für einen Künstler nicht nur zu erkennen, dass die Formen schon da sind und ein von ihm unabhängiges Leben führen, sondern vor allem auch, dass die individuelle künstlerische Formbildungsarbeit eben aus diesem Grunde wichtig ist. In Anlehnung an Carl Einstein, den Theoretiker des Kubismus, und Walter Benjamin, den Archäologen der Moderne, begründet Georges Didi-Huberman die Präsenz der Form in der Form selbst, nämlich „im Spiel ihrer Formation und ihrer Präsentation“.2 Was heißt das? Formen sind nicht auf ihre zeichenhafte Dimension reduzierbar, sonden sie sind immer auch in ihrer Materialität, in ihrer Textur wahrzunehmen. Eine Form hat eine bestimmte Anmutung, die mit ihrer Stofflichkeit zusammenhängt, ist zugleich aber auch das Ergebnis eines Prozesses, der stets mitzudenken ist. Die auf ein Kleidungsstück genähte und als Fotografie publizierte Initiale hat eine andere Intensität als gezeichnete oder gemalte Initialen. Wenn die Formbildungsarbeit Bestandteil der Identität und der Wirkung der Formen ist, dann gehören auch der Transformationsprozess, aus dem die Form hervorgegangen ist, und damit die verschiedenen Deformationen, die eine Form im Verlauf des bildnerischen Prozesses durchlaufen hat, zu ihrer Bedeutung. F steht für Federle, aber auch für Flicken und Formen. Wichtig aber ist: Die Richtung der Formbildungsarbeit ist nicht vorgegeben. Ob Federle Kompositionen seiner Gemälde auf den Initialen seines Namens aufbaut, um die Identität der Arbeiten zu festigen, oder genau umgekehrt, um die Initialen seines Namens und somit auch seine eigene Person in einem umfassenderen Sinnzusammenhang zu verorten, wie dies die Arbeit Der letzte Buchstabe meines Namens ist der erste des Todes (1984) im Bildtitel andeutet, bleibt für den Betrachter offen.
2) Georges Didi-Huberman, Was wir sehen, blickt uns an. Zur Metapsychologie des Bildes, München 1999, S. 217.
II.
Im Jahr 2009 malte Helmut Federle innerhalb von fünf Wochen neun kleine Gemälde. Der Künstler spricht von einer größeren Werkgruppe, denn in den Jahren davor sind im Atelier nur wenige Bilder und kaum Zeichnungen entstanden. Die neuen Gemälde nehmen ein Motiv auf, das im Werk seit den späten siebziger Jahren immer wieder auftauchte, aber nie Ausdruck in einem eigenen Zyklus fand. In einem Interview, das der Künstler anlässlich der Ausstellung von fünf Arbeiten aus dieser Werkgruppe bei Peter Blum in New York der Zeitschrift The Brooklyn Rail gab, erwähnt er als Vorläuferbild die Arbeit Innerlight (1985).3 Es handelt sich bei den Gemälden aus der neuen Werkgruppe um luzide, sanfte Nachtbilder, die an das Licht der romantischen Malerei erinnern. Dieses Licht, das durch die dunkle, dünnflüssig aufgetragene, auf einigen Gemälden sogar mehrmals abgewaschene Farbe dringt, ist allen Werken dieser Gruppe gemeinsam. Die Gemälde üben einen merkwürdigen Sog auf den Betrachter aus – merkwürdig deshalb, weil zugleich offen bleibt, ob das Licht einem entgegenströmt oder umgekehrt, das Bild dem Auge einen Durchgang ins Helle eröffnet. Sind wir vor dem Gemälde oder im Gemälde? Im selben Interview zitiert Federle den Architekten Louis Kahn mit den Worten „Gott ist im Material“. Mit dem Motiv des nicht lokalisierbaren, permanenten Lichts ist die Thematik der Spiritualität verbunden, welche in der abstrakten Malerei seit ihren Anfängen zentral war und hier noch zur Sprache kommen wird. Einige dieser in Erdfarben oder in grauen und schwarzen Farbtönen gemalten Tunnelbilder lassen den Blick ins Bodenlose stürzen. Bilderinnerungen aus 2001 – A Space Odyssey (1968) von Stanley Kubrick stellen sich ein, vor allem jene fantastische Stelle gegen Ende des Films, die zeigt, wie der überlebende Astronaut von einem kaleidoskopischen Strudel von Raum und Zeit mitgerissen wird, um als Sternenkind wiedergeboren zu werden. Vor Augen habe ich auch das kleine, um das Jahr 1940 entstandene Aquarell eines in die Tiefe stürzenden Menschen des Baslers Theo Modespacher (1897–1955). Vordergründig ein Bild tragischen Inhalts, bleibt bei genauerer Betrachtung offen, ob der Körper die Straße durchschlagen hat oder sich vielleicht sogar in einem Zustand der Schwerelosigkeit befindet. Wie auch immer: Es ist ein Bild der Dematerialisation. Federles Gemälden fehlt die visuell spektakuläre Dimension und die Beschleunigung der Zeitreise im Film. Es gibt in diesen Bildern jedoch eine kompositorische Linearität sowie eine Einfachheit, die wie bei Kubrick auf eine leere Stelle hinführen und eine vergleichbare Ausweglosigkeit der Bilderfahrung erzeugen.
Kompositorisch nehmen die neuen Bilder eine besondere Stellung im Werk Federles ein, weil der Künstler mit ihnen die Orientierung an der aus Horizontalen und Vertikalen gebildeten Bildstruktur hinter sich lässt. Die Dynamisierung des Bildfeldes durch diagonale Bewegungen setzt in der Malerei erst mit den Arbeiten des Zyklus Edelweiss (Ausführung) ein, findet sich im zeichnerischen Werk aber schon früh. Spiralformen und Diagonalen treten bemerkenswerterweise in der Zeichnung immer wieder auf, sind in der Malerei aber selten: Eine bedeutende Ausnahme stellt das Gemälde Spirale Intro 1/2, 1/3 etc (1985) dar. Was die jüngsten Bilder mit allen früheren Werken verbindet, ist die Auseinandersetzung mit dem Bildzentrum. 1997 von Erich Franz auf die Bedeutung des Mittebezugs und der Dezentralität in seiner Malerei angesprochen, antwortete Federle: „Schon in meinen Arbeiten aus den siebziger Jahren, den grauen Bildern mit den dunklen Formen an den Rändern, oder noch früher in meinen Landschaftsbildern sehen wir ein frontales Verhalten. Das heißt, es gibt keine illusionistische Gestalttiefe. Das Bild zeigt sich in der Ausdehnung über die Fläche. Dies ist für meine Arbeit wesentlich. Das heißt jedoch nicht, dass nicht eine empfundene Tiefe evozierbar wäre. Diese Frontalität ruft natürlich sowohl formal wie emotional nach einer im Gegenüber verstandenen Positionierung. Da spielt die Mitte oder, wie ich es nennen möchte, die relative Mitte eine wichtige Rolle.“4 Diese Suche nach der „relativen Mitte“ strukturiert auch die neuen Gemälde. Wiederum arbeitete Federle von den Rändern her auf ein optisches Zentrum des Bildfeldes hin, jedoch meist nicht parallel zum Rand des rechteckigen Bildträgers wie in früheren Werkgruppen, sondern schräg über Eck und in einer Kreisbewegung, die dazu führte, dass Teile der gemalten Flächen wieder übermalt wurden und die Gemälde eine gerichtete räumliche Tiefendimension erhielten. Federle verwendete eine wässrige, nicht deckende Farblösung, so dass die verschiedenen Farbschichten in ihrer Anlage sichtbar blieben.
Der Künstler selbst spricht nicht von Farbe, sondern von „gefärbem Wasser“. Er arbeitete vom Hellen ins Dunkle und verstärkte durch dieses Vorgehen die Strahlkraft des hellen Grundes, auf dem die Gemälde aufbauen. Aus diesem Vorgehen entstanden im Bildfeld harmonisch ineinanderliegende geometrische Figuren, fast ausschließlich Pentagone. Die Fünf ist in der Alchemie die Zahl des Menschen und der belebten Natur, da sie eines der formbestimmenden Prinzipen der organischen Natur ist. Durch sie wird die „quinta essentia“, die spirituelle Gesetzmäßigket in jeder Materie ausgedrückt, mithin von der unbelebten Natur unterschieden. Kristalle bauen auf dem Sechseck auf, die meisten Blüten dagegen auf einem fünfeckigen Stern, einem Pentagramm. Das Zentrum dieser Form wiederum bildet ein Pentagon. Es symbolisiert den Mikrokosmos. Man denke in diesem Zusammenhang auch an die kleine Papierarbeit Two Forms Kompositorisch nehmen die neuen Bilder eine besondere Stellung im Werk Federles ein, weil der Künstler mit ihnen die Orientierung an der aus Horizontalen und Vertikalen gebildeten Bildstruktur hinter sich lässt. Die Dynamisierung des Bildfeldes durch diagonale Bewegungen setzt in der Malerei erst mit den Arbeiten des Zyklus Edelweiss (Ausführung) ein, findet sich im zeichnerischen Werk aber schon früh. Spiralformen und Diagonalen treten bemerkenswerterweise in der Zeichnung immer wieder auf, sind in der Malerei aber selten: Eine bedeutende Ausnahme stellt das Gemälde Spirale Intro 1/2, 1/3 etc (1985) dar. Was die jüngsten Bilder mit allen früheren Werken verbindet, ist die Auseinandersetzung mit dem Bildzentrum. 1997 von Erich Franz auf die Bedeutung des Mittebezugs und der Dezentralität in seiner Malerei angesprochen, antwortete Federle: „Schon in meinen Arbeiten aus den siebziger Jahren, den grauen Bildern mit den dunklen Formen an den Rändern, oder noch früher in meinen Landschaftsbildern sehen wir ein frontales Verhalten. Das heißt, es gibt keine illusionistische Gestalttiefe. Das Bild zeigt sich in der Ausdehnung über die Fläche. Dies ist für meine Arbeit wesentlich. Das heißt jedoch nicht, dass nicht eine empfundene Tiefe evozierbar wäre. Diese Frontalität ruft natürlich sowohl formal wie emotional nach einer im Gegenüber verstandenen Positionierung. Da spielt die Mitte oder, wie ich es nennen möchte, die relative Mitte eine wichtige Rolle.“
Diese Suche nach der „relativen Mitte“ strukturiert auch die neuen Gemälde. Wiederum arbeitete Federle von den Rändern her auf ein optisches Zentrum des Bildfeldes hin, jedoch meist nicht parallel zum Rand des rechteckigen Bildträgers wie in früheren Werkgruppen, sondern schräg über Eck und in einer Kreisbewegung, die dazu führte, dass Teile der gemalten Flächen wieder übermalt wurden und die Gemälde eine gerichtete räumliche Tiefendimension erhielten. Federle verwendete eine wässrige, nicht deckende Farblösung, so dass die verschiedenen Farbschichten in ihrer Anlage sichtbar blieben. Der Künstler selbst spricht nicht von Farbe, sondern von „gefärbem Wasser“. Er arbeitete vom Hellen ins Dunkle und verstärkte durch dieses Vorgehen die Strahlkraft des hellen Grundes, auf dem die Gemälde aufbauen. Aus diesem Vorgehen entstanden im Bildfeld harmonisch ineinanderliegende geometrische Figuren, fast ausschließlich Pentagone. Die Fünf ist in der Alchemie die Zahl des Menschen und der belebten Natur, da sie eines der formbestimmenden Prinzipen der organischen Natur ist. Durch sie wird die „quinta essentia“, die spirituelle Gesetzmäßigket in jeder Materie ausgedrückt, mithin von der unbelebten Natur unterschieden. Kristalle bauen auf dem Sechseck auf, die meisten Blüten dagegen auf einem fünfeckigen Stern, einem Pentagramm. Das Zentrum dieser Form wiederum bildet ein Pentagon. Es symbolisiert den Mikrokosmos. Man denke in diesem Zusammenhang auch an die kleine Papierarbeit Two Forms (Zwei Formen der Anthroposophie) (1983), die Skulpturales evoziert. Eine der beiden Formen auf diesem Blatt ist aus einem Sechseck, die andere aus einem Fünfeck entwickelt. In den neuen Gemälden entstehen die Polygone aus dem malerischen Prozess. Sie haben kristallin-kubische und organisch-vegetative Eigenschaften. Die Form ist keine Konstruktion für eine Komposition, wie es sie im Frühwerk gibt, sondern eine bildhafte gewachsene Struktur.
Frontalität und relative Mitte sind Begriffe, die sich auch für die Besprechung von Caspar David Friedrich anbieten, mit dem Federle schon früh und immer wieder in Verbindung gebracht wurde. Die Frontalität ist in den sehr bekannten und für die Diskussion des Erhabenen als einer genuin modernen ästhetischen Erfahrung wichtigen Gemälden Mönch am Meer (1810) und Wanderer über dem Nebelmeer (1818) das zentrale Kompositionsprinzip. In beiden Werken steht im Bildzentrum ein einsamer Mensch, vom Betrachter abgewandt, im Banne der Natur. Da ist aber auch jene Zeichnung eines Selbstporträts von 1810, auf die der ungarische Schriftsteller Laszlo F. Földényi in seiner schönen Monografie über Caspar David Friedrich aufmerksam macht und die ihn vor allem wegen der Darstellung und Wirkung des rechten Auges interessiert. Er schreibt dazu: „Die quälenden Widersprüche, von denen sein Leben ebenso zerfurcht ist wie seine Gesichtszüge, treten neben diesem Auge in den Hintergrund – nicht nur, weil es geometrischer Mittelpunkt des Bildes und Zentrum des Kreises ist, den die Kopfform, das wellige und lockige Haupt- und Barthaar und die Falten der Kleidung bilden, sondern auch, weil es zu uns spricht, anders als die Züge, die eher nur etwas mitteilen. Es drängt sich so intensiv vor, dass es fast wie ein Relief wirkt; es scheint gar nicht zu diesem Gesicht zu gehören. Im Gegensatz zum linken Auge, das die melancholischen Gesichtszüge unterstreicht, lebt das rechte sein eigenes Leben: Es blickt nicht aus dem Gesicht nach außen, sondern saugt alles in sich; es betrachtet nicht die Welt, sondern schaut nach innen. Wie auf zahlreichen Gemälden der Mond oder die Sonne, ist dieses Auge mehr als es selbst: ein explosiv angespannter Punkt, der alle Möglichkeiten in sich trägt, eine Origo, in der die Welt sich selbst betrachtet.“5 Földényi nennt es ein „nächtliches Auge“, das den Betrachter gefangen nimmt. Er betont die konzeptuelle Natur von Caspar David Friedrichs Seelenbildern und deren abstrakte Struktur.
Wenn Federle seine Malerei in die Tradition der Romantik stellt und von der Sehnsucht als einem Grundantrieb seiner Kunst spricht, so ist damit keine schwärmerische Malerei gemeint, sondern eine genaue, absolute Arbeit wie diejenige von Caspar David Friedrich im 19. Jahrhundert oder das Werk von Paul Klee, Wassily Kandinsky, Jackson Pollock oder Barnett Newman im 20. Jahrhundert, in denen Abstraktion und sinnliche Ausführung keine Gegensätze darstellen. Federles geometrisch-abstrakte Malerei schließt in ihrer Struktur zwar an die Bildsprache der Moderne und insbesondere an deren Bildvorstellungen an, seine dem Rationalen entgegenwirkende Farbigkeit will dabei aber die innere Welt des Betrachters ansprechen. Er malt oft in gedämpftem, trockenem Braun, Grün, Gelb und Grau, verwendet auch gerne Schwarz und Weiß, aber kaum reine Farben. Frontalität und relative Mitte sind Begriffe, die sich auch für die Besprechung von Caspar David Friedrich anbieten, mit dem Federle schon früh und immer wieder in Verbindung gebracht wurde. Die Frontalität ist in den sehr bekannten und für die Diskussion des Erhabenen als einer genuin modernen ästhetischen Erfahrung wichtigen Gemälden Mönch am Meer (1810) und Wanderer über dem Nebelmeer (1818) das zentrale Kompositionsprinzip. In beiden Werken steht im Bildzentrum ein einsamer Mensch, vom Betrachter abgewandt, im Banne der Natur. Da ist aber auch jene Zeichnung eines Selbstporträts von 1810, auf die der ungarische Schriftsteller Laszlo F. Földényi in seiner schönen Monografie über Caspar David Friedrich aufmerksam macht und die ihn vor allem wegen der Darstellung und Wirkung des rechten Auges interessiert. Er schreibt dazu: „Die quälenden Widersprüche, von denen sein Leben ebenso zerfurcht ist wie seine Gesichtszüge, treten neben diesem Auge in den Hintergrund – nicht nur, weil es geometrischer Mittelpunkt des Bildes und Zentrum des Kreises ist, den die Kopfform, das wellige und lockige Haupt- und Barthaar und die Falten der Kleidung bilden, sondern auch, weil es zu uns spricht, anders als die Züge, die eher nur etwas mitteilen. Es drängt sich so intensiv vor, dass es fast wie ein Relief wirkt; es scheint gar nicht zu diesem Gesicht zu gehören. Im Gegensatz zum linken Auge, das die melancholischen Gesichtszüge unterstreicht, lebt das rechte sein eigenes Leben: Es blickt nicht aus dem Gesicht nach außen, sondern saugt alles in sich; es betrachtet nicht die Welt, sondern schaut nach innen. Wie auf zahlreichen Gemälden der Mond oder die Sonne, ist dieses Auge mehr als es selbst: ein explosiv angespannter Punkt, der alle Möglichkeiten in sich trägt, eine Origo, in der die Welt sich selbst betrachtet.“ Földényi nennt es ein „nächtliches Auge“, das den Betrachter gefangen nimmt. Er betont die konzeptuelle Natur von Caspar David Friedrichs Seelenbildern und deren abstrakte Struktur.
Wenn Federle seine Malerei in die Tradition der Romantik stellt und von der Sehnsucht als einem Grundantrieb seiner Kunst spricht, so ist damit keine schwärmerische Malerei gemeint, sondern eine genaue, absolute Arbeit wie diejenige von Caspar David Friedrich im 19. Jahrhundert oder das Werk von Paul Klee, Wassily Kandinsky, Jackson Pollock oder Barnett Newman im 20. Jahrhundert, in denen Abstraktion und sinnliche Ausführung keine Gegensätze darstellen. Federles geometrisch-abstrakte Malerei schließt in ihrer Struktur zwar an die Bildsprache der Moderne und insbesondere an deren Bildvorstellungen an, seine dem Rationalen entgegenwirkende Farbigkeit will dabei aber die innere Welt des Betrachters ansprechen. Er malt oft in gedämpftem, trockenem Braun, Grün, Gelb und Grau, verwendet auch gerne Schwarz und Weiß, aber kaum reine Farben.
3) „Helmut Federle in Conversation with John Yau and Chris Martin“, in: The Brooklyn Rail. Critical Perspectives on Arts, Politics, and Culture, New York, November 2009, S. 22–25.
4) Erich Franz: „Gespräch mit Helmut Federle“, in: Helmut Federle. XLVII Biennale Venedig, Ausst.-Kat., Bern/Baden 1997, S. 18.
5) Laszlo F. Földényi, Caspar David Friedrich: Die Nachtseite der Malerei, München 1993, S. 19f.
III.
Ein in vielerlei Hinsicht wichtiger Ort in Federles persönlicher Geografie ist New York, die Stadt Barnett Newmans, dessen Werk er während seines Studiums bei Franz Fedier in den sechziger Jahren im Kunstmuseum Basel kennenlernte. Die amerikanische Nachkriegsmalerei – neben Newman vor allem Mark Rothko und Clifford Still – interessierte den jungen Federle und bestärkte den angehenden Maler sowohl in seiner Auffassung von reduktiver Malerei als auch in seiner Identifikation mit dem Bild vom Künstler als gesellschaftlichem Außenseiter. Ab 1979 lebte Federle für vier Jahre in Manhattan, ein Aufenthalt, der sehr anregend, künstlerisch produktiv und prägend war. Es war die Zeit der Wiederkehr der Erzählung und des Körpers in die Kunst. Manhattan ist jedoch nicht nur die Stadt, in welcher die amerikanischen Künstler zu einer eigenen Sprache fanden, die in den fünfziger Jahren auch international maßgebend wurde, sondern auch die Stadt, in die zahllose Menschen vor dem Krieg in Europa geflohen waren, darunter viele namhafte Künstler. Piet Mondrian war einer von ihnen. Er starb 1944, im Geburtsjahr von Helmut Federle, in New York. Erst vier Jahre zuvor über Paris aus London eingewandert, eröffnete er mit Broadway Boogie-Woogie (1942–1943) und dem unvollendeten Victory Boogie-Woogie (1942–1944) der abstrakten Malerei neue Möglichkeiten, welche spätere Generationen erprobten.
Noch vor dem Krieg, 1936, war im Museum of Modern Art die Ausstellung Cubism and Abstract Art zu sehen. Im Katalog dieser bedeutenden Ausstellung findet sich ein Schema der modernen Kunst, das die Genealogie der klassischen Avantgarden nachzeichnet und zugleich einen Ausblick auf die nähere Zukunft wagt. Aus dieser Perspektive folgen die historischen Avantgarden auf Cézanne, van Gogh, Gauguin und Seurat, entfalten sich in einem kurzen Zeitraum in einer Vielzahl von Bewegungen und münden bald in einige wenige Hauptströmungen. Erwähnung finden Surrealismus, Purismus, De Stijl, Bauhaus und Konstruktivismus. Alfred H. Barr Jr., der dieses Diagramm entwarf, unterscheidet innerhalb der zeitgenössischen Kunst zwischen nicht-geometrischer abstrakter Kunst und geometrischer abstrakter Kunst. Der Name Marcel Duchamp fehlt in dieser Geschichte der Avantgarde, denn seine Bedeutung wurde erst in den sechziger Jahren erkannt; um Namen wie Jackson Pollock oder Barnett Newman zu erwähnen und dem Modernismus in der Entwicklung der Abstraktion den gebührenden Platz zu geben, war es 1936 noch zu früh. Als der Maler Ad Reinhard nur ein Jahrzehnt später einen Stammbaum der modernen Kunst unter der Überschrift „How to look at Modern Art in America“ als Cartoon publizierte, spiegelte sich darin eine um einiges komplexere Situation der zeitgenössischen amerikanischen Szene wider. Er zeichnete einen Baum, dessen Krone im Wesentlichen aus zwei mächtigen Ästen besteht, wobei derjenige der Abstraktion kräftiger und weniger gefährdet erscheint als derjenige der Figuration, der durch die vielen verschiedenen hier zugeordneten Künstlerinnen und Künstler so stark belastet erscheint, dass sich erste Brüche im Holz zeigen. Rückblickend wird allerdings klar, dass auch die Geschichte der Abstraktion ein Prozess der ständigen Transformation war und diese Gefährdung daher ebenso zu ihrer Identität gehört.
Der amerikanische Kunsthistoriker Timothy J. Clark schildert anhand von Jackson Pollock, wie die Frage nach dem Verhältnis von Abstraktion und Figuration in den Kern des modernen Bildverständnisses führt.6 Für Künstler, die wie Helmut Federle an der Abstraktion weiterarbeiten, stellt sich diese Frage in der täglichen Arbeit auch heute noch immer von Neuem. Clark diskutiert dieses unsichere Verhältnis ausgehend von Fotografien Cecil Beatons, die 1956 im Modemagazin Vogue erschienen und zwei Mannequins vor Arbeiten Jackson Pollocks zeigen. Der Text fragt nach „dem öffentlichen Leben von Pollocks Malereien“ und behauptet, dass die kapitalistische Kultur jede Arbeit gegen das Figurative überlistet und „zu einem Aspekt ihrer eigenen Figuration macht“. Den Modernismus versteht er als eine Kunstrichtung, „die ohne den Glauben ihrer Erschaffer, dass das, was sie taten, wirklich Widerstand oder ein Hinausgehen über das normale Kulturverständnis war, keinen Sinn hätte.“ Clark interessiert an Pollock, dass dieser, wie alle abstrakten Künstler der ersten Phase der Moderne, „die Beziehung des Bildes zur Welt der Dinge“ beenden will, dabei aber entdeckt, dass dies nicht möglich ist, weil sich der Körper immer in die Malerei einschreibt. Als Willem de Kooning 1951 im Museum of Modern Art auf einem Symposium zur Frage „What Abstract Art Means to Me“ sprach, stellte er die künstlerische Subjektivität ins Zentrum seiner Argumentation und bestritt die Möglichkeit einer unpersönlichen Form in der Kunst: „Malerei – jede Art von Malerei, jeder Stil von Malerei – überhaupt zu malen eigentlich – ist heute eine Art zu leben, ein Lebensstil sozusagen. Dort ist ihre Form beheimatet.“7
6) Timothy J. Clark, Jackson Pollock. Abstraktion und Figuration, Hamburg 1994.
7) Jed Perl, New Art City. Manhattan und die Erfindung der Gegenwartskunst, München/Wien 2006, S. 142.
IV.
Die Welt, in der wir gegenwärtig leben, nennt der deutsche Kunsthistoriker Hans Belting eine „technische Weltzivilisation“8. Die Kultur steht, wie die Wirtschaft, die Technik, die Politik und die Wissenschaft, im Zeichen einer medial vermittelten Globalisierung. Unter diesen neuen zivilisatorischen Bedingungen, die nach Belting den „Prozess der Auflösung lokaler Kulturen“ herbeiführen, „fällt einzelnen Trägern [dieser Kultur], die in natürlichen Körpern leben, eine neue Bedeutung zu, wie sie zu anderen Zeiten Emigranten besaßen. Es bedarf also eines anderen Begriffs von Kultur, um diese spurenhafte Streuung von Tradition zu entdecken, die an einzelne Körper und ihre Geschichte gebunden ist.“9 Mit Blick auf Helmut Federle ist festzuhalten, dass sein Begriff von Kunst und seine Praxis der Malerei die Zugehörigkeit zur westlichen Tradition betonen. Andererseits versteht er sein Werk als spezifische Ausdrucksform von Kunst schlechthin und unterstreicht dies, in dem er seine Arbeiten immer wieder mit Werken anderer Kulturen, Epochen und Traditionen in Zusammenhang bringt. Jan Thorn-Prikker schreibt: „Im Kern ist Federles Kunst metropolitan und international. Souverän lässt er die Grenzen von Ländern, Kontinenten und Zeiten hinter sich und bewegt sich als Weltbürger in fremden Kulturen, als wären sie ihm seit jeher vertraut. Sein Feld ist die Welt, seine Zeit ist die Geschichte, seine Bezugspunkte sind die Hochkulturen aller Zeiten.“10
Der Künstler nimmt Partei für eine Kunst, die aus dem Bewusstsein entsteht, dass das Individuum durch seine Prägungen auch einen kollektiven Körper repräsentiert und somit – vielleicht im Sinne Beltings – ein „Ort der Bilder“ ist. Diesen Sachverhalt gilt es, künstlerisch zu reflektieren: „Die Bedeutung der abstrakten Form ist in höchstem Maße trivialisiert und relativiert durch eine Konsumgesellschaft mit einem zynischen Bewusstsein, die die Form als leere Hülle braucht. Die Form ist von ihrer spirituellen Qualität entleert worden.“11 An anderer Stelle sagt er, es sei für ihn als Künstler bedeutsam, „dass alle bildinternen Fragen Spiegel übergeordneter existentieller Fragen bleiben“.12 Was dies heute bedeuten könnte wird vielleicht deutlicher, wenn wir daran erinnern, dass die Abstraktion des frühen 20. Jahrhunderts eine Bewegung gegen vergangene Formen war, um einem neuen, modernen Wirklichkeitsverständnis zu entsprechen. Der Modernismus brachte künstlerische Formen hervor, welche die Erfahrungen des modernen Lebens darstellten, reflektierten, in die Zukunft verwiesen und ihnen einen Sinn gaben. In Farewell to an Idea bezeichnet Timothy J. Clark diese Ära als unsere Antike und noch dazu als einzige, die wir haben. Wenn seine Darstellung des Modernismus zutrifft, und vieles spricht dafür, dann handelt es sich dabei um eine abgeschlossene Epoche und den „Boden, der die Grundlage heutiger künstlerischer Ideen und Methoden bildet, übersät mit den archäologischen Überbleibseln des Modernismus“.13 Die Postmoderne, so Clark, habe die Krise des Modernismus als Verfall der Modernität selbst missverstanden und nicht beachtet, dass die Entzauberung der Welt, wie Max Weber den Zivilisationsprozess nannte, längst vollzogen war. Ist die „technische Weltzivilisation“ also der Realität gewordene Traum der Modernen?
8) Hans Belting, Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2001, S. 60.
9) Ebd.
10) Jan Thorn-Prikker, „Die Konstruktion des Geheimnisses“, in: Helmut Federle. Nietzsche-Haus Sils Maria, Ausst.-Kat., Basel 2004, S. 12.
11) Zit. aus Aufzeichnungen Helmut Federles von 12. September 1987, in: Helmut Federle. Bilder – Zeichnungen 1975–1988, Bielefeld 1989, S. 162.
12) Zit. nach Thorn-Prikker (wie Anm. 10), S. 25f.
13) Mark Lewis, „Ist die Moderne unsere Antike?“, in: Documenta Magazine Nr. 1–3, 2007, Reader, Köln 2007, S. 54.
14) Vgl. Roman Kurzmeyer/Roger Perret (Hrsg.), Dunkelschwestern. Annemarie von Matt – Sonja Sekula, Zürich 2008, S. 230.
15) John Cage publizierte 1961 unter in dem Band Silence Texte und Vorträge von ihm, darunter auch den „Vortrag über nichts“, den er 1949 im Artist’s Club in New York gehalten hatte.
16) Lewis (wie Anm. 13), S. 54.
Erstveröffentlichung in: Helmut Federle, Kuratiert von Roman Kurzmeyer, Ausst.-Kat. Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien 2010, S. 21-52.